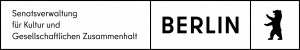24.11.2025 –
26.11.2025
AUGEN AUF: Handeln gegen Antisemitismus im Kunstmuseum – Fortbildung für Akteur:innen der Kunst- und Kulturvermittlung

- Über die Fortbildung
- Programm
- Formate und Referent:innen
- Organisatorisches
- Kosten | Anmeldung
- Förderung
Dreitägige Fortbildung für Kunstvermittler:innen, kulturelle und politische Bildner:innen, Museumsmacher:innen und Künstler:innen.
Zusammenarbeit zwischen dem Kunsthaus Dahlem und dem Georg Kolbe Museum
Über die Fortbildung
Antisemitismus und Rassismus sind tief in Geschichte, Gegenwart und Gesellschaft verwoben – als weltanschauliche Systeme ebenso wie als alltägliche Erfahrungen. Sie wirken bis in unsere Institutionen hinein, auch in Museen – oft unsichtbar, aber mit weitreichenden Folgen. Wie gehen wir als Vermittler:innen und Museumsarbeiter:innen verantwortungsvoll damit um?
In Zeiten zunehmender antisemitischer und rassistischer Vorfälle in Deutschland und Europa ist es umso dringlicher, kulturelle Bildungsräume als Orte aktiven Handelns gegen Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung zu stärken. Kunstmuseen tragen dabei eine besondere Verantwortung: Sie sind Räume der Repräsentation, der Erinnerung und der Auseinandersetzung – und stehen zugleich in der Pflicht, ihre eigene Geschichte sowie ihre Vermittlungsarbeit kritisch zu hinterfragen und weiterzuentwickeln.
Mit der Fortbildung AUGEN AUF: Handeln gegen Antisemitismus im Kunstmuseum laden das Kunsthaus Dahlem und das Georg Kolbe Museum dazu ein, gemeinsam neue Perspektiven für eine diskriminierungskritische kulturelle Bildung und Vermittlungssarbeit in Kunstmuseen zu entwickeln. Mit thematischen Inputs, praxisnahen Workshops und interdisziplinärem Austausch werden Strategien erarbeitet, wie Sprache, Bilder und Narrative sensibel und kritisch reflektiert und transformiert werden können. Die Fortbildung eröffnet einen Raum für kollegialen Austausch, vertieftes Lernen und solidarisches Handeln – mit dem Ziel, antisemitismuskritische und rassismussensible Bildungsarbeit im Museum nachhaltig zu stärken.
Programmkuratorinnen: Anne Fäser (Kunsthaus Dahlem), Barbara Campaner (Georg Kolbe Museum)
Programm
Siehe unten oder laden Sie es im PDF-Format herunter:
![]() AUGEN AUF: Fortbildung Programmflyer
AUGEN AUF: Fortbildung Programmflyer
/
Tag 1
Montag, 24. November 2025
Ort: Kunsthaus Dahlem (Käuzchensteig 8, 14195 Berlin)
Informationen zur Anfahrt hier
9:30 – 10:00
ANKUNFT UND KAFFEE
10:00 – 10:45
BEGRÜßUNG UND EINSTIEG IN DIE FORTBILDUNG
Anne Fäser (Kuratorin für Outreach, Kunsthaus Dahlem),
Barbara Campaner (Kuratorin für Outreach, Georg Kolbe Museum) und
Fee Wedepohl (Moderation der Fortbildung)
10:45 – 12:15
IMPULS UND DISKUSSIONSRUNDE
Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten der antisemitismuskritischen Museumsarbeit
Livia Erdösi (Initiativgruppe Antisemitismuskritik im Museumsbund Österreich)
12:15 – 13:15
Mittagspause
13:15 – 16:30
VERTIEFUNGSWORKSHOPS
Workshop 1: Antisemitismus und Umgang mit Emotionen
Désirée Galert (Bildungsreferentin und Expertin zu Themen Antisemitismus, Rassisumus, jüdisch-muslimischer Dialog, Demokratiebildung)
Workshop 2: Wie können wir über Diskriminierung in den Austausch kommen? Und wie kommen wir gemeinsam ins Handeln?
Judith Boegner und Pia Schlickeiser (7xjung – Der Lernort von Gesicht Zeigen!)
16:30 – 17:00
MODERIERTER AUSTAUSCH UND CHECK-OUT
Moderation: Fee Wedepohl
/
Tag 2
Dienstag, 25. November 2025
Ort: Georg Kolbe Museum (Sensburger Allee 25, 14055 Berlin)
Informationen zur Anfahrt hier
9:30 – 10:00
ANKUNFT UND KAFFEE
10:00 – 10:30
BEGRÜßUNG UND CHECK-IN
Barbara Campaner (Kuratorin für Outreach, Georg Kolbe Museum) und
Fee Wedepohl (Moderation der Fortbildung)
10:30 – 12:00
IMPULS UND DISKUSSIONSRUNDE
Antisemitismus in Kunst, Ausstellungen und musealer Praxis – Herausforderungen und Perspektiven
Marina Chernivsky (Kompetenzzentrum antisemitismuskritische Bildung und Forschung/KOAS)
12:00 – 13:00
Mittagspause
13:00 – 16:30
VERTIEFUNGSWORKSHOPS
Workshop 1: Erinnerung und Identität – ein künstlerischer Workshop
Atalya Laufer und Antonia Debus (Künstler:innen u.a. bei Dagesh – Jüdische Kunst im Kontext von Dialogue Perspectives e. V.)
Workshop 2: Zwischen Werk und Wirkung: Antisemitismus im Ausstellungsalltag
Daniel Heinz und Awa Yavari (freiberufliche Bildungsreferent:innen u.a. bei der Bildungsstätte Anne Frank)
16:30 – 17:00
MODERIERTER AUSTAUSCH UND CHECK-OUT
Moderation: Fee Wedepohl
/
Tag 3
Mittwoch, 26. November 2025
Ort: Kunsthaus Dahlem (Käuzchensteig 8, 14195 Berlin)
Informationen zur Anfahrt hier
9:30 – 10:00
ANKUNFT UND KAFFEE
10:00 – 10:30
BEGRÜßUNG UND CHECK-IN
Anne Fäser (Kuratorin für Outreach, Kunsthaus Dahlem) und
Fee Wedepohl (Moderation der Fortbildung)
10:30 – 12:00
IMPULS UND DISKUSSIONSRUNDE
Trialog – Multiperspektivisches Gespräch über Israel und Palästina
mit Zakariyya Meißner & Lili Zahavi
Palästina-Israel Projekt – Ein Projekt der Gesellschaft im Wandel gGmbH
12:00 – 13:00
Mittagspause
13:00 – 16:30
WORKSHOP
Macht kommt von Machen!
Radikale Töchter
16:30 – 17:00
ABSCHLUSS UND CHECK-OUT
Moderation: Fee Wedepohl
Formate und Referent:innen
(der Reihenfolge des Programms folgend)
1. Livia Erdösi: Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten der antisemitismuskritischen Museumsarbeit
Der Auftaktinput beschäftigt sich mit den Spezifika antisemitismuskritischer Museumsarbeit und unterstreicht die Notwendigkeit einer ganzheitlichen und selbstreflektierten Sensibilisierung zum Thema Antisemitismus und seiner Kritik in Museen. Dabei geht es um die institutionsübergreifende Professionalisierung von Museumsarbeiter:innen, sowie darum, eine fundierte, gesamtinstitutionelle Haltung zu entwickeln und Museen als antisemitismuskritische Orte zu gestalten. Dies bedeutet auch, sich den eigenen Leerstellen in der musealen Arbeit, sowie der institutionellen Geschichte und deren Kontinuitäten bis in die Gegenwart zu widmen.
Livia Erdösi arbeitet im Jüdischen Museum sowie im Volkskundemuseum in Wien und ist Mitinitiatorin der Initiativgruppe Antisemitismuskritik im Museumsbund Österreich. Zuvor war sie u.a. an der Akademie der bildenden Künste Wien sowie bei den Arolsen Archives und der European Holocaust Research Infrastructure tätig. Sie studierte Kultur- und Sozialanthropologie, Public Policy und Museologie.
2. Désirée Galert: Antisemitismus und Umgang mit Emotionen
Im Workshop setzen sich die Teilnehmenden mit diversen Erscheinungsformen von Antisemitismus und deren Kontinuitäten bis heute auseinander. Der Ansatz der Widerspruchstoleranz als ein wichtiges Konzept der politischen Bildung wird anhand erprobter Methoden praxisnah vorgestellt und die Rolle von Emotionen dabei diskutiert. Die Teilnehmenden tauschen sich über Fallstricke in öffentlichen Debatten, persönliche Zugänge zum Umgang mit Emotionen sowie Erfahrungen im musealen Arbeitsalltag aus. Gemeinsam werden Chancen und Herausforderungen antisemitismuskritischer Bildung reflektiert und erörtert, ob und wie innerhalb der Museumsprogramme Raum für verschiedene Emotionen gleichzeitig geschaffen werden kann.
Désirée Galert leitet und koordiniert seit 2018 die Praxisstelle Bildung und Beratung, eine Anlaufstelle, die Berliner Schulen bei antisemitischen Vorfällen beratend zur Seite steht. Sie entwickelt, implementiert und evaluiert Workshops und Fortbildungen auf Basis unterschiedlicher Ansätze der politischen Bildung für diverse Zielgruppen und Einrichtungen wie Museen oder Gedenkstätten. Sie studierte Islamwissenschaft, Politikwissenschaft und Ethnologie.
3. Judith Boegner und Pia Schlickeiser: Wie können wir über Diskriminierung in den Austausch kommen? Und wie kommen wir gemeinsam ins Handeln?
Im Workshop werden ausgewählte Methoden der historisch-politischen Bildung bei 7xjung – Der Lernort von Gesicht Zeigen! gemeinsam mit den Teilnehmenden diskutiert und erprobt. Bei 7xjung arbeiten Referent:innen mit Kindern und Jugendlichen zu Diversität und Diskriminierung. Die Exponate und Methoden des Lernorts veranschaulichen Kontinuitäten von Ausgrenzung vor, während und nach dem Nationalsozialismus. Die Bildungsarbeit verknüpft zeitgeschichtliche Perspektiven mit dem Ziel, Engagement gegen Antisemitismus, Rassismus und jede Form von Diskriminierung zu fördern.
Judith Boegner ist als Projektleiterin für die Workshoparbeit am Lernort 7xjung zuständig. Zuvor hat sie in Kollektiven sowie in Museen im Feld der Kunstvermittlung gearbeitet. Sie interessiert sich besonders für die Schnittstelle von kultureller und politischer Bildung und die Gestaltung inklusiver Zugänge. Sie hat Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis studiert.
Pia Schlickeiser arbeitet als Bildungsreferentin am Lernort 7xjung. Sie hat Geschichtswissenschaften und Deutsche Philologie studiert. Im Anschluss an ein Referendariat arbeitete sie mehrere Jahre als Lehrerin an einer Berliner Gemeinschaftsschule.
4. Marina Chernivsky: Antisemitismus in Kunst, Ausstellungen und musealer Praxis – Herausforderungen und Perspektiven
Der Vortrag gibt Einblicke in aktuelle Dynamiken und Herausforderungen im Umgang mit Antisemitismus in Kunst, Ausstellungen und musealer Praxis. Ausgangspunkt sind die Folgen des 7. Oktober 2023, die zu einer Zunahme antisemitischer Gewalt geführt und die kulturelle Auseinandersetzung mit Antisemitismus vor neue Herausforderungen gestellt haben. Im Zentrum steht die Frage, wie Museen als öffentliche Orte der Bildung Verantwortung übernehmen und unter welchen Bedingungen Bildungsarbeit gegen Antisemitismus wirksam werden kann. Der Vortrag diskutiert Qualitätsmerkmale antisemitismuskritischer Arbeit und deren Integration in kuratorische und vermittlerische Praxis, auch unter Einbezug des Dialogischen Reflexionsansatzes (DiRA).
Marina Chernivsky ist Psychologin und Verhaltenswissenschaftlerin. Sie arbeitet und forscht zu transgenerationalem Trauma, Antisemitismus in Institutionen und den Folgen des 7. Oktober für die jüdische Community. Sie leitet das von ihr gegründeten Kompetenzzentrum antisemitismuskritische Bildung und Forschung (KOAS) sowie die Beratungsstelle OFEK e. V.
5. Atalya Laufer und Antonia Debus: Erinnerung und Identität – ein künstlerischer Workshop
Wie prägen Erinnerungen unser Selbstverständnis, und wie lassen sie sich künstlerisch erfahrbar machen? Im Workshop wird untersucht, wie persönliche Geschichten und kollektive Erinnerungen zu Antisemitismus und jüdischer Geschichte, gestalterisch umgesetzt werden können. Ausgehend von individuellen Erfahrungen, familiären Erzählungen und historischen Bezügen entstehen mit Zeichnung und Collage visuelle Erzählformen zwischen Dokumentation und künstlerischer Reflexion. Verschiedene Methoden werden erprobt, um die eigene Praxis zu erweitern. Im Mittelpunkt steht die Verbindung von Kunst, Geschichte, Migration und kultureller Identität sowie die Rolle der Kunst als Raum des Erinnerns und der kritischen Auseinandersetzung mit Antisemitismus.
Antonia Debus ist Bildungsreferentin mit Fokus auf Menschenrechte, Selbstbestimmung und Antidiskriminierung und arbeitet u.a. für das Anne Frank Zentrum, Dagesh – Jüdische Kunst im Kontext und das Jüdische Museum Berlin. Ihre Arbeit begann in der zivilen Seenotrettung. Sie studierte Soziale Arbeit mit Schwerpunkt Trauma und befindet sich im Masterstudium der Medienpsychologie.
Atalya Laufer ist eine in Berlin lebende Künstlerin, die mit Zeichnung, Collage und Installation arbeitet. Sie studierte Fine Arts am Central Saint Martins College in London und absolvierte ihren Master an der Universität der Künste Berlin. In ihrem Werk verknüpft sie persönliche Geschichten mit kollektiver Geschichte und untersucht Themen wie kulturelles Erbe, Erinnerung und familiäre Überlieferung.
6. Daniel Heinz und Awa Yavari: Zwischen Werk und Wirkung: Antisemitismus im Ausstellungsalltag
Im Workshop führen Awa Yavari und Daniel Heinz in Geschichte, Gegenwart und Dynamiken des Antisemitismus ein – mit Fokus auf kuratorische und vermittelnde Praxis. Dabei wird der Blick für Bildsprachen, Kontexte und institutionelle Entscheidungen geschärft, die Wahrnehmungen prägen. Statt fertiger Lösungen bietet der Workshop Orientierungswissen und Impulse für kontinuierliche Auseinandersetzung, denn Antisemitismus verändert sich. Im Zentrum steht ein kollegialer Austauschraum für Herausforderungen und Unsicherheiten. An realen Fällen werden Grenzziehungen zwischen Kritik und Antisemitismus sowie das Zusammenspiel von Kunstfreiheit, Betroffenenschutz und institutioneller Verantwortung diskutiert. Ziel ist mehr Souveränität in der Aushandlung – im Ausstellungsraum, im Team und in der öffentlichen Kommunikation.
Awa Yavari ist Studentin der Rechtswissenschaft und freiberufliche Bildungsreferentin u.a. bei der Bildungsstätte Anne Frank. Sie ist in der historisch-politischen Bildungsarbeit aktiv, mit einem besonderen Fokus auf antimuslimischen Rassismus, Antisemitismus und verschiedenen Formen der Diskriminierung.
Daniel Heinz ist Geschäftsführer der pbb – Postmigrantische Bildung und Beratung, einer in Berlin ansässigen russlanddeutsch-jüdischen MSO, die politische Bildungsarbeit mit Popkultur verbindet. Außerdem ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Osnabrück und freiberuflicher Referent u.a. bei der Bildungsstätte Anne Frank.
7. Zakariyya Meißner & Lili Zahavi: Trialog – Multiperspektivisches Gespräch über Israel und Palästina
Das Trialog-Projekt ist ein multiperspektivi-sches Gesprächsformat der Gesellschaft im Wandel gGmbH über den Nahostkonflikt. Ausgehend vom Ausbruch des Krieges in Israel und in Gaza am 7. Oktober 2023 und den damit einhergehenden gesellschaftlichen Folgen, einschließlich der starken Emotionalisierung, widmet sich das Projekt der großen Herausforderung, das Thema besprechbar zu machen. Das Ziel der Trialoge ist, gemeinsam mit Menschen einen Ort des gegenseitigen Zuhörens, der Verständigung, des Aushaltens und des Wachsens zu schaffen. Gleichzeitig soll dem Unwissen über die verschiedenen Grautöne, den zunehmenden menschenfeindlichen Vorurteilen und zahlreichen Verschwörungstheorien im Zusammenhang des Nahostkonfliktes entgegengewirkt werden.
Lili Zahavi ist Filmemacherin, deren Wurzeln in Israel und der DDR liegen. In beiden Welten zu Hause, wuchs sie nach der Wende in Berlin auf. Sie studiert Filmregie im Diplom an der Filmakadedmie Baden Württemberg. Lili arbeitet als Schauspielerin, Regisseurin und Autorin. Seit der Schulzeit engagiert sie sich für soziale und politische Projekte. So ist sie als künstlerische Referentin in Projekten mit Jugendlichen für Pluralismus und Demokratie und gegen Rassismus und Antisemitismus aktiv und engagiert sich als Trialogpatin bei der Gesellschaft im Wandel.
Zakariyya Meißner hat in Freiburg Islamwis-senschaft studiert und bringt langjährige Er-fahrung in der Prävention von islamistischer und rechtsextremistischer Radikalisierung mit. Er bietet freiberuflich Unterstützung zu Themen wie dem Nahost-Konflikt, diskriminierungskritischer Organisationsentwicklung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit an. Als Deutsch-Palästinenser findet er es besonders herausfordernd, sich dem Thema Nahost-Konflikt zu entziehen, insbesondere in Deutschland, wo der öffentliche Diskurs oft stark polarisiert und unsachlich ist.
8. Radikale Töchter: Macht kommt von Machen!
Antisemitismus und andere Formen von Diskriminierung, Rechtsextremismus und Politikverdrossenheit: Wir brauchen neue Ideen und Maßnahmen, wenn wir aktuelle Herausforderungen und Probleme lösen wollen. Vor allem braucht wir eins: Mehr Mut! Deswegen trainieren wir in unseren Workshops gemeinsam unseren Mutmuskel. In unseren Workshops vermitteln wir Ansätze der Aktionskunst. Dabei befähigen wir Menschen, mit den Mitteln der Aktionskunst ihre Anliegen und Ziele zu formulieren und Wege zu entwickeln, diese zu erreichen. Anhand unserer »Methoden der Aktionskunst« tauchen die Teilnehmenden in einen Arbeitsprozess ein. Unser Ziel: Menschen inspirieren und ermutigen, Menschen ins Handeln bringen.
Die Radikale Töchter empowern Menschen durch Aktionskunst Haltung zu zeigen, ins demokratische Handeln zu kommen und sich für politische Themen einzusetzen, die ihnen am Herzen liegen. Kreativ, humorvoll und wirkungsvoll.
Organisatorisches
Es gibt einen barrierefreien Zugang zu den Räumlichkeiten. Wir bieten eine Dolmetschung in Deutsche Lautsprache und Deutsche Gebärdensprache (DGS) an. Dolmetschende: Dorothea Bach, Juliane Bier, Nicole Maresch, Mona J. Zwinzscher
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie andere Formen der Unterstützung benötigen.
Wünschenswert ist eine Teilnahme an allen drei Tagen.
Awareness: Wir möchten, dass sich alle während der gesamten Veranstaltung wohlfühlen. Für ein respektvolles und sicheres Miteinander ist ein Awareness-Team vor Ort und unterstützt bei Grenzüberschreitungen oder Konfliktsituationen. Awareness-Team: Eva da Silva Antunes Alves, Aline Bosche, Tula Hiliger, Rosa Witt.
Konzeption unterstützt durch Yael (-) & Ida (sie/ihr) von Initiative Awareness e.V.
Die Fortbildung wird begleitet mit Graphic Recording durch Jens Nordmann.
Kosten | Anmeldung
Die Fortbildung ist gebührenfrei.
Die Teilnehmer:innenzahl ist begrenzt. Anmeldung erforderlich unter: outreach@kunsthaus-dahlem.de
FÖRDERUNG
Das Projekt wird ermöglicht aus Mitteln des Aktionsfonds zur Unterstützung von Projekten gegen Antisemitismus.